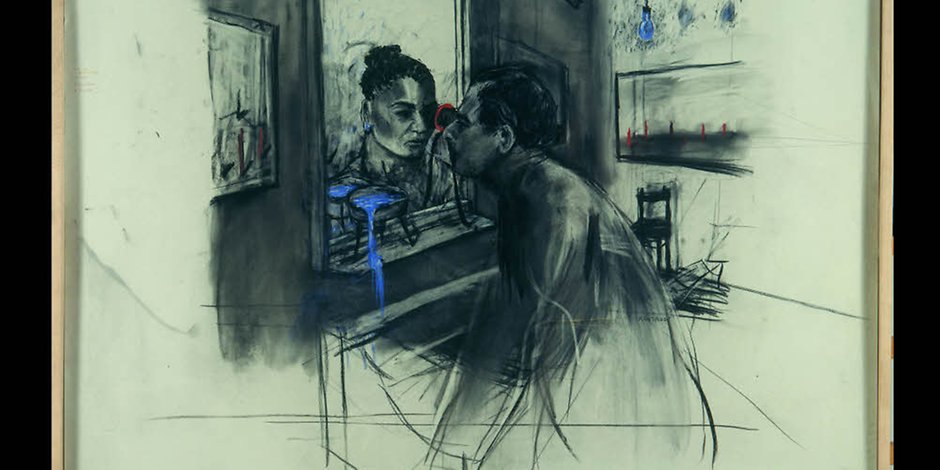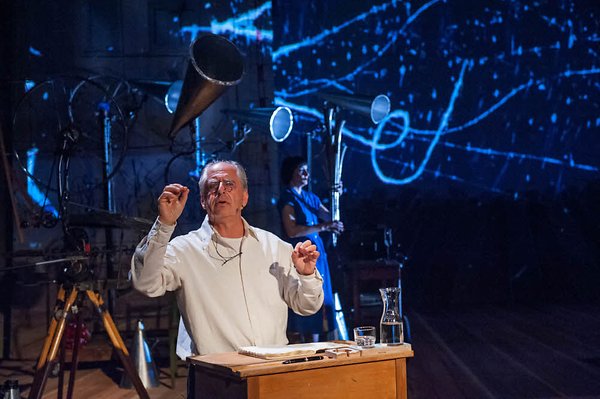Lyrische Impressionen
Obwohl der Juni noch nicht weit fortgeschritten war, legte sich bereits eine große Hitze über die Stadt. Der Asphalt begann zu glühen, die Häuserschluchten wie ein Backofen zu heizen. Trotzdem zwitscherten die Sperlinge und Amseln, noch finden sie genügend Wasserstellen.
Doch diese viel zu frühe Hitze verheißt nichts Gutes, sie macht benommen und treibt eine lähmende Unruhe in die Knochen.